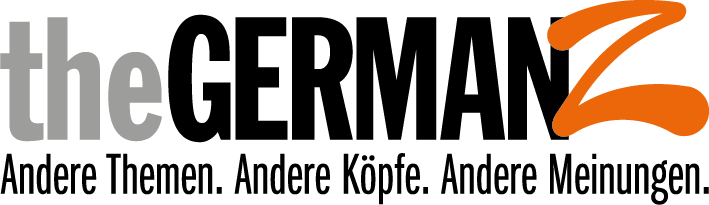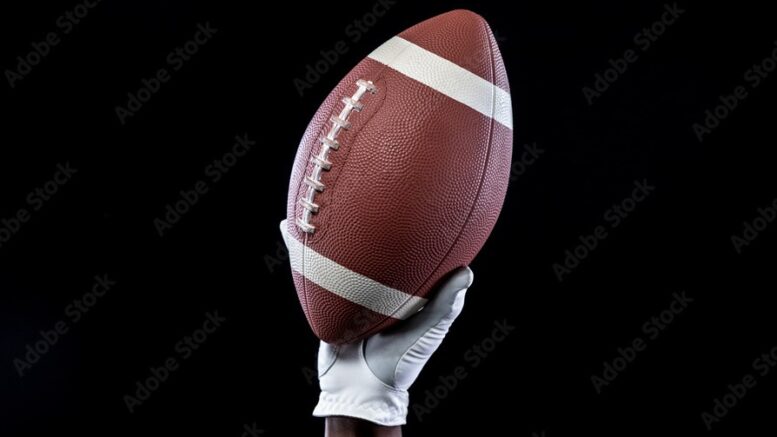von KLAUS KELLE
SANTA CLARA – Zugegeben, ich habe als junger Mann eine Weile gebraucht, bis ich die Regeln des American Football begriffen habe. Aber meine ersten Erfahrungen mit der uramerikanischsten aller US-Sportarten fanden nicht bei der NFL statt, nicht in San Francisco oder Tampa, sondern in Freiburg im Breisgau. Da war ich Chefredakteur beim „Freiburger Wochenbericht“ und wir waren Trikotsponsor der „Freiburg Sacristans“, zu Deutsch: der Freiburger „Messdiener“. Ich habe heute noch irgendwo ein altes Basecap von damals in irgendeiner Kiste zu Hause liegen, mit dem Schriftzug des Teams.
Wir saßen damals jeden Spieltag mit 300 Leuten, vorwiegend Jungs, auf einem Rasen nahe des Dreisamstadions, aßen Burger, tranken Cola und hatten einfach Spaß.
Später, als wir im Rheinland lebten, waren wir regelmäßig bei Rhein Fire Düsseldorf, einem der beiden wichtigsten, publikumsstärksten und erfolgreichsten deutschen Teams, die allerdings damals fast ausschließlich mit jungen, hungrigen Spielern aus den USA bestückt waren, die hofften, nach ihrer Rückkehr dort Profiverträge bei einem NFL-Team zu bekommen. Und als die „Leipzig Kings“ vor drei Jahren in finanzielle Schwierigkeiten gerieten und die Pleite drohte, gehörte ich zu einer kleinen Runde, die überlegte, ob man Hilfe für die Leipziger auf die Beine stellen könnte.
Es gelang leider nicht, sie mussten sich aus dem Spielbetrieb zurückziehen und meldeten Insolvenz an.
Ich traf damals Daniel Thywissen, einen langjährigen Freund von mir und heute Manager von Rhein Fire, in einem Hotel in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs zum Kaffee. Er erklärte mir das Problem, warum es ausgerechnet beim sportbegeisterten Publikum in der Messestadt Leipzig nicht zündete und im Schnitt wenig mehr als 1.500 zahlende Zuschauer kamen. Weil Ostdeutsche den American Football als einen Sportwettkampf wahrnehmen. American Football ist natürlich auch ein Sport, klar, es geht um Ergebnisse, um kräftige Jungs, die rennen. Aber vor allem ist es ein Familienevent.
Es ist Spaß pur, es ist die Show drei Stunden vor Beginn, es ist die Bühne mit US-Rockbands, es sind Burger und Wings, Coca-Cola und Pepsi. Niemand bei Rhein Fire oder Galaxy würde während der Halftimeshow (Halbzeit) auf den Gedanken kommen, nachzuschauen, wie der eigene Club in Echtzeit gerade in der Tabelle steht. Und außerdem heißt die Halftimeshow nicht umsonst so, wie sie heißt …
Heute Abend also das Levi’s Stadium, und die ganze Welt ist irgendwie dabei – jedenfalls erwarten sie wieder fast eine Milliarde Zuschauer vor den Bildschirmen weltweit. Es gibt kein vergleichbares singuläres Sportevent auf unserem Planeten. Im Stadion selbst sind nachher (0.30 Uhr MEZ) 68.500 Fans dabei.
Allein in den USA sitzen alljährlich etwa 115 Millionen Menschen gebannt vor den Bildschirmen – jeder Dritte. Es ist die Zeit der „Super Bowl Parties“, bei denen alle sportlichen Rivalitäten für ein paar Stunden ruhen und das Gemeinschaftsgefühl und der Patriotismus absolut im Vordergrund stehen.
Während man bei anderen Sportarten die Werbeauszeiten nutzt, um Nachschub aus dem Kühlschrank zu holen oder aufs Klo zu gehen, sind die Spots beim Super Bowl eines der Highlights. Die kleinen Filmchen sind Meisterwerke, oft spielen bekannte Hollywood-Schauspieler darin mit; sie sind besetzt mit Hollywood-A-Promis. Für einen einzigen 30-Sekunden-Spot bekommen Unternehmen anschließend eine Rechnung über 7 Millionen US-Dollar. Wer sich das leisten kann, der zählt zur globalen Champions League der Werber.
Und, kein Witz, der „nationale Geflügelrat“ schätzt, dass an diesem Wochenende 1,45 Milliarden Chicken Wings verzehrt werden. Super Bowl, das ist nach Silvester auch für die Pizzalieferdienste der stressigste Tag des Jahres. „Pizza Hut“ und „Domino’s“ verkaufen dann jeweils zwei Millionen Pizzen. Was meinen Sie, wie viele davon per Mail bestellt werden? Würde man die „Epstein Files“, die gerade veröffentlicht wurden, in einem Zusammenhang mit dem Super Bowl betrachten, ich bin sicher, viele der „Pizza“-Verschwörungserzählungen erledigten sich dann von alleine.
Und klar, Bier wird in den Vereinigten Staaten auch getrunken – heute etwa 1,2 Milliarden Liter.
Ich bin ja schon ein wenig älter, aber ich bin nachher natürlich auch wieder dabei mit Freunden in einem Lokal im Brandenburgischen zur Super-Bowl-Party mit Chicken Wings und Burgern. Ich überlege noch, ob ich mir meine „Make America Great Again“-Cap oder die alte von den „Sacristans“ aus Freiburg aufsetze. Wer dann gewinnt, ist mir eigentlich egal. Der Bessere soll es machen.
Bis zur Halbzeit werde ich durchhalten, das ist sicher. Ich muss die Werbespots sehen. Unbedingt. Und natürlich die Halftimeshow von „Bad Bunny“, dem derzeit weltweit angesagtesten Rapper. Der stammt aus Puerto Rico und hat eine lange Zankerei mit US-Präsident Donald Trump. Der hält es für ganz „schrecklich“, dass die NFL Bunny zum Auftritt eingeladen hat. Eine Schande sei das, sagt der mächtigste Mann der Welt.
Aber die Geschichte hat auch einen anderen Blickwinkel: Bei einer Wahlveranstaltung für Trump hatte 2024 ein „Comedian“ Puerto Rico als „Insel aus Müll“ bezeichnet, was Bunny nicht gefiel. Der unterstützte dann im Wahlkampf Kamala Harris gegen Trump, was Harris allerdings auch nichts genützt hat.
Der Super Bowl ist wie das große Schaufenster Amerikas. Er zeigt eine Nation, deren Menschen das Große lieben, die den Wettkampf feiert und die es versteht, aus einem Sportwettkampf ein episches Ereignis zu machen. Es geht um Helden, um die Geschichte „Vom Tellerwäscher zum Millionär“, um das Gefühl, dass für die Amerikaner an diesem einen Abend alles möglich ist. Wenn die Nationalhymne erklingt und die Kampfjets über das Stadion donnern, spürt man einen Stolz der Leute auf ihr eigenes Land, bei dem in Deutschland der Verfassungsschutz auf den Plan gerufen würde.
Bildquelle:
- Football: adobe.stock