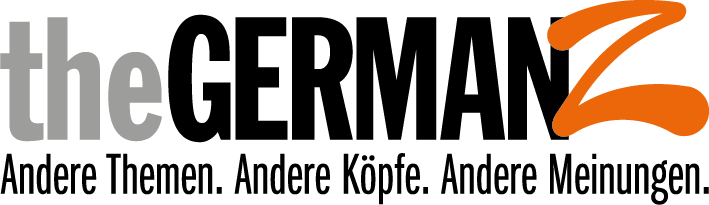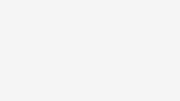von FELIX HONEKAMP
Gerade hat die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ihren Jahresbericht für 2016 veröffentlicht (GermanZ hat berichtet). Darin ist von einem weiteren Anstieg der Zahl der Drogentoten die Rede: 1.333 Menschen, 9 Prozent mehr als im Vorjahr, die durch Drogenmissbrauch umgekommen sind. 2015 gab es noch einen Anstieg von rund 19 Prozent, 2014 der ungefähr gleiche prozentuale Anstieg. Damit scheint ein Trend gebrochen, der bis 2012 sinkende Opferzahlen auswies. Guter Rat ist wie immer teuer, hindert aber die Politik nicht daran, nach Gesetzesänderungen zu rufen: Verschärfung von Strafen einerseits, Methadonversorgung oder die Ausgabe kostenfreier Drogen andererseits, sind die üblichen Patentrezepte. Auf verlorenem Posten stehen in einem solchen Umfeld die Befürworter einer generellen Liberalisierung der Drogenpolitik, und sei es nur für – vermeintlich? – weiche Drogen wie Cannabis.
Dabei sollte in einem solchen Umfeld die liberale Position recht klar sein: Drogenbesitz, -konsum und auch -handel gehören bei vielen Libertären zu den sogenannten „opferlosen Verbrechen“. Die Logik dahinter ist einfach: Wer Drogen konsumiert, tut das in aller Regel aus freiem Willen, jedenfalls wird er meistens nicht direkt gezwungen. Analog zu Alkohol oder auch Tabak sollte also hier gelten: Wer es nehmen will, soll es halt nehmen, den Schaden dann aber auch selbst verantworten. Umgekehrt wird auch argumentiert, dass es gerade ein Drogenverbot ist, dass so mancher mit der Kriminalisierung einhergehenden Verelendung Vorschub leistet. Auf einem freien Drogenmarkt könnte sich ein Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage herausbilden, das manche Drogenkarriere wesentlich mildern könnte. Als Vergleich wird die Prohibition von Alkohol in den USA von 1920 bis 1933 herangezogen, die einerseits zu einem Wachtsums- und Ertragsschub für das organisierte Verbrechen geführt hat und gleichzeitig so manchen Selbstversorger an gepanschtem Schnaps elendig verrecken ließ. Wenn diese Prohibition ein Fehler war, warum sollte es mit Marihuana oder selbst Heroin, LSD oder neuen synthetischen Drogen anders sein?
Wer sich damit seine Gesundheit ruiniert, der tut das bewusst, jedenfalls kann er das wissen. Warum sollte es also wieder mal der Staat sein, der bestimmt, was legal genommen werden darf und was nicht? Und birgt eine rigide Drogenpolitik nicht auch den Kern anderer staatlicher Einflussnahmen auf einen schädlichen Lebenswandel? Bei Tabak gehen die Einschränkungen immer weiter, eine verordnete Lebensmittelampel ist kaum zu unterschätzen als Vorbereitung eines langfristigen Verbots ungesunder Lebensmittel, und wer weiß, ob nicht irgendwann Risikosportarten bis hin zum Skifahren in den Blick der Politik geraten? Opferlos ist auch ein solches Verhalten … wenn man mal von gesellschaftlichen Kosten absieht, die aber letztlich die Konsequenz einer zwangsweisen Vergemeinschaftung von Gesundheitskosten sind. Wer sich heute beim Skifahren ein Bein bricht, bekommt über die Krankenkasse die Kosten der Behandlung auch von demjenigen bezahlt, der sich einem solchen Risiko gar nicht aussetzt; die Lungenkrebs- und Fettleberbehandlung zahlt auch der Abstinenzler mit. Mit derartigen Kosten wird darum auch immer wieder bei der Verschärfung von Rauchergesetzen argumentiert: Der Raucher schadet in diesem Bild der Gemeinschaft – das tut er aber nur, weil die zur Solidarität gezwungen wird. In einem freien Gesundheitsmarkt gäbe es das nicht, da muss sich ein Raucher eine entsprechende – private – Versicherung suchen … oder auf bestimmte Behandlungen verzichten. Klingt brutal? Ist aber fairer als ein scheinheiliges Verstecken der Politik hinter einer verfehlten Gesundheitspolitik.
Also das Gesundheitssystem privatisieren und dann auch die Drogenpolitik weiter liberalisieren? Mit einem solchen Konzept gewinnt man natürlich keine Wahlen, darum werden wir diese Forderungen so schnell von keiner großen Partei hören: Der politische Liberalismus in Deutschland fordert sowas schon lange nicht mehr, und die parlamentarischen Vertreter einer liberaleren Drogenpolitik sind ansonsten auch noch nicht mit Privatisierungsbestrebungen aufgefallen. Nur auf diese Art aber lässt sich auch in diesem Gebiet die abhandengekommene Selbstverantwortung wieder stärken. Es mag Grenzen bei der Drogenliberalisierung geben, wo der Konsum zu einer erheblichen Gefährdung für die Gesellschaft durch Bewusstseinsveränderungen der Nutzer führt. Aber es kann niemand erklären, warum das Feierabendbier legaler sein sollte als der Joint. Nur Vorsicht: Auf diesen Gedanken könnten auch Etatisten kommen, die auch ersteres einer stärkeren Regulierung unterziehen wollen.
Bildquelle:
- Marihuana: pixabay