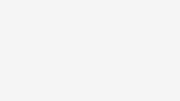von THOMAS DÖRFLINGER
BERLIN – Geld ins Ausland transferieren, damit sich ein Potentat irgendwo in der Welt wieder etwas leisten kann, wovon er schon im Überfluss hat? Und das auf Kosten des deutschen Steuerzahlers? Da kocht die Volksseele, und auf die hat Dietrich Kantel in unserer Zeitung wohl auch geschielt, als er seinen Beitrag über deutsche Entwicklungshilfe schrieb. Aber: Die Zeiten, in denen Kaiser Bokassa in Bonn empfangen wurde und mit Luxuskarosse und einem fetten Scheck wieder nach Hause flog, sind längst vorbei. Die deutsche Entwicklungshilfe gehorcht schon seit geraumer Zeit anderen Grundsätzen. Daher also zur Versachlichung ein Blick in die Praxis. Als langjähriger Ehrenamtlicher in den Leitungsgremien von Kolping International weiß ich, wovon ich rede, auch wenn der Kollege Kantel vielleicht an dieser Stelle die Nase rümpft und meint, da schreibe einer aus der Sozialindustrie.
Was Dietrich Kantel schildert, liest sich wie eine Geschichte aus den 1960er Jahren der Entwicklungspolitik. Dabei soll gar nicht verschwiegen werden, dass auch heute noch Projekte scheitern und vielleicht auch bisweilen Geld verschwindet. Aber: Nur der, der nichts tut, macht auch keine Fehler. Die Migrationsströme der letzten Jahre und Jahrzehnte dürften jedoch selbst dem letzten Beobachter klargemacht haben: Wer nicht will, dass Hunderttausende sich auf den Weg machen, muss etwas für die Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort tun. Und ein Land, das gestern noch Subsistenzwirtschaft auf dem Agrarsektor betrieben hat, wird auch durch noch so große Anstrengungen nicht bis übermorgen zur Industrienation.
Hilfe zu Selbsthilfe
Staatliche Stellen, konfessionelle Hilfswerke, Organisationen wie die Welthungerhilfe oder das Rote Kreuz – fast alle arbeiten nach dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“. Wo Hunger herrscht, nutzt es wenig, Brot zu verteilen. Man muss den Menschen zeigen, wie Getreide angebaut wird, wie die Ernte verbessert und widerstandsfähig gemacht werden kann, wie mit den Überschüssen eine regionale Vermarktung aufgezogen wird. Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry bringt das auf die einfache Formel: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, offenen Meer.“ Nachhaltigkeit statt Scheckbuch-Diplomatie!
Es ist mitnichten so, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) das Geld einfach blindlings z.B. nach Afrika schaufelt. Fakt ist, die politischen Voraussetzungen im Zielland sind immer auch Gradmesser für die Art der Kooperation. Schon seit mehreren Jahren gibt es etwa in der Demokrtaischen Republik Kongo seitens des BMZ keinen Draht zu zentralstaatlichen Stellen mehr. Stattdessen werden Projekte zur Selbsthilfe auf der regionalen Ebene mit NGOs verwirklicht. Und dass die NGOs in Deutschland (zu Recht) einer durchaus peniblen Kontrolle unterworfen sind, kann jeder bestätigen, der schon einmal dort tätig gewesen ist.
Und die Forderung nach Mikrokrediten ist längst entwicklungspolitische Praxis. Kolping International etwa ermöglicht so einer Frau in Indien die Anschaffung einer Kuh; mit dem Verkauf der Milch sichert sie die Existenz ihrer Familie. Eine Frau in Benin hat sich mit Hilfe eines Kleinkredits ein paar Schweine zugelegt. Der Verkauf der gemästeten Tiere schafft nicht nur die materielle Basis für die Familie, sondern ermöglicht der Tochter den Schulbesuch. In Ruanda, das Beispiel habe ich mir selbst vor einigen Jahren angesehen, bewirtschaften kleine Gruppen ihre eigenen Felder, die sie zuvor per Mikrokredit erworben haben. Die Früchte, die nicht selbst verzehrt werden, können weiterverarbeitet oder direkt verkauft werden. Auf der Rückreise dachte ich: Das hat vielleicht mehr mit Sozialer Marktwirtschaft zu tun, als das, was das hochindustrialisierte Deutschland so anstellt.
It’s education, stupid!
Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Und die fängt nicht bei der Universität an, sondern in der Grundschule – auch für Erwachsene. Rechnen, Lesen, Schreiben: 2018 nahmen an einer Alphabetisierungskampagne bei Kolping in Benin 345 Menschen in 15 Regionalzentren teil; die Erfolgsquote lag bei 95 Prozent. Ein kleines Beispiel, zugegeben. Aber: In einem Land wie Benin, wo heute gerade einmal 40 Prozent überhaupt des Lesens mächtig sind, braucht es Geduld, bis Verbesserungen tatsächlich spürbar werden und auch gesellschaftliche Erfolge zeitigen.
Wer einen Blick auf viele Entwicklungsprojekte in Afrika oder auch Lateinamerika wirft, stellt darüber hinaus fest: In überwiegender Zahl sind es Frauen, die den Laden schmeißen. Sie sind Bäuerinnen, Lehrerinnen, Schuhmacherinnen. Vermutlich leisten drei dieser kleinen Projekte in Afrika einen besseren und effektiveren Beitrag zum gesellschaftlichen Fortschritt als fünf C-4-Professuren für Gender-Gedöns in Deutschland.
Zur Bildung gehören in einem zweiten Schritt nach der Beherrschung der elementaren Kulturtechniken auch ethische Grundsätze. Ja, es gibt in vielen Staaten Korruption. Die lässt sich auch ad hoc nicht beseitigen. Wie aber bekämpft man sie? Die Zusammenarbeit mit einschlägigen Staaten einstellen? Dadurch verändert sich nichts. Von außen hineinregieren, um die Zustände zu bessern? Das macht es eher noch schlimmer. Strukturen ändern sich nur, wenn sich Menschen ändern. Das braucht einen verdammt langen Atem. Von Rückschlägen, die es immer geben wird, darf man sich nicht entmutigen lassen. Und: Die Ansprüche müssen runter. Wo gestern ein Autokrat geherrscht hat, entsteht nicht morgen die Westminster-Demokratie. Immer dran denken: Für den Weg zu einem funktionierenden Rechtsstaat von Dauer hat Deutschland weit über 100 Jahre gebraucht- mit allen zwischenzeitlichen Folgen, die bekannt sind.
Bildquelle:
- Schule_Kinder_Afrika: pixabay