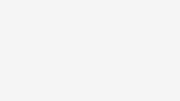von DIETRICH KANTEL
BERLIN – Es ist gut: In unserer Zeitung wird thematisch gerungen. In den Zeiten Merkelscher Alternativlosigkeit ist das zur Ausnahme geworden. Haltungsjournalismus rangiert zu oft vor kritischem Journalismus. Leider. Unsere Zeitung ist dem kritischen Journalismus verpflichtet. Und damit dem Leser. Nicht den Regierenden. Und auch nicht irgendeinem politisch korrekten Mainstream.
Aus der Gegenrede des Kollegen Thomas Dörflinger zu meiner Kritik an der praktizierten Entwicklungshilfe, in der Milliarden verschwendet werden, wird erkennbar, dass auch in dieser Thematik das Sein das Bewusstsein bestimmt. So kommt es zu sehr unterschiedlichen Wertungen. Es gereicht meinem Kollegen Thomas Dörflinger zur Ehre, dass er eingangs seiner Gegenrede freimütig seine eigene Befangenheit offenbart: Als langjährig dem Internationalen Kolpingwerk, einem der großen Player der Sozial- und Entwicklungshilfeindustrie Vorstehender, ist er zum Thema naturgemäß befangen.
Etat des BMZ: Mal eben 38 Prozent mehr
Seine subjektive Gegendarstellung ist aber durchaus wichtig. Denn er stellt im Wesentlichen den Mainstream der Gutmeinenden zum Thema Entwicklungshilfe dar. Genau mit diesen Argumenten wird den schon länger in Deutschland Lebenden ein schlechtes Gewissen eingeredet. Damit wird privat immer mehr Geld eingesammelt bzw. der staatliche Entwicklungshilfeetat immer weiter aufgestockt. So wurde allein im derzeitigen vierten Kabinett Merkel der Etat des BMZ, des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, mal eben um 38 Prozent aufgebläht: von rund neun Milliarden Euro 2017 auf 12,4 Milliarden im laufenden Haushaltsjahr. Und die größeren Nichtregierungsorganisationen, zu denen auch das Kolpingwerk zu rechnen ist, hängen, neben ihren Mitgliedsbeiträgen und Spendeneinnahmen, sämtlich am Tropf staatlicher Entwicklungshilfe. Da fällt Kritik am bestehenden System naturgemäß schwer.
Meine kritische Betrachtungsweise entspringt dagegen der Position des außenstehenden Beobachters. Da sind falsche Rücksichtnahmen nicht angezeigt. Auch nehme ich für mich nach über 25 Jahren der Befassung mit den Verhältnissen in Afrika und über 60 überwiegend beruflich bedingten Aufenthalten im „Subsaharian Africa“ intime Kenntnis von mindestens zwölf Staaten des südlichen Afrika für mich in Anspruch. Und mit meiner Kritik, die nicht, wie vom Kollegen Glauben gemacht, eine Betrachtung von Entwicklungspolitik der 1960er Jahre darstellt, stehe ich keineswegs alleine.
Bonner Memorandum: Afrika muss sich selbst entwickeln
Unter Federführung der entwicklungspolitischer Wissenschaftler Prof. Illy (Freiburg), Prof. Molt (Trier), Prof. Nuscheler (Duisburg) und Prof. Tetzlaff (Bremen) verabschiedete eine Konferenz mit renommierten Praktikern der Entwicklungshilfe das Bonner Memorandum „Entwicklungshilfe für Afrika beenden – Afrika muss sich selbst entwickeln (wollen)“.
Die bisherige Entwicklungshilfe für afrikanische Staaten mache keinen Sinn, so die Experten in ihren Feststellungen aus dem Jahr 2018. Vor allem weil:
– Die dort Herrschenden haben offensichtlich nur das Ziel, sich persönlich zu bereichern.
– Die Kapitalflucht aus diesen Ländern höher ist als die Summe der Entwicklungsgelder.
– Die bäuerliche Landwirtschaft nicht umfassend unterstützt wird.
– Fruchtbare Landstriche an Länder wie die Golfstaaten oder China vergeben werden.
– Die Handelschancen zwischen den afrikanischen Ländern selber nicht genutzt werden.
So rufen sie im Bonner Memorandum die Afrikaner auf, sich endlich auf eigene Stärken zu besinnen. Die Entwicklung ihrer Länder von Innen heraus zu betreiben und ihre wertvollen Rohstoffe wie Gold, Platin, Diamanten, Phosphate, Coltan, Kobald, Erdgas und Erdöl endlich im eigenen Land weiterzuverarbeiten. Soweit zur staatlichen Entwicklungshilfe.
„Jeder gespendete Euro kommt an“
Wichtig ist des Kollegen Dörflinger Gegendarstellung auch, weil er eine bedeutende Differenzierung beleuchtet, die zugegeben, nicht Gegenstand meiner Betrachtung war: Die großartige Rolle einiger (weniger !) privater Organisationen und die Rolle der übrigen …
Mit Sicherheit kann das Internationale Kolpingwerk zu denjenigen Organisationen gezählt werden, die wirklich „vor Ort“ aus ihrer christlich-sozialen Selbstverpflichtung mit den Kolpingnetzwerken Großes im Kleinen bewegen. Ich hege da persönlich nicht die geringsten Zweifel. Jedoch gibt es da (überwiegend) ganz andere. Ich kenne die aus langjähriger anwaltlicher Befassung mit deren Intransparenz. Da geht Selbstversorgung des hauptamtlichen Apparates vor. Und da wird in den Manager-Etagen inzwischen richtig gut verdient. Ehrenamtliche Bescheidenheit war früher. Heute ist es halt eine Industrie. „Hilfe zur Selbsthilfe“ klingt unheimlich gut. Ist zu oft aber zu einer abgedroschenen Platitüde der Spendenwerbung verkommen. Keine Organisation, die um Spenden bettelt, kommt heute ohne diesen Slogan aus.
In Bilanzen wird getrickst. Auch in der Entwicklungsindustrie.Tricksereien für „Jeder Spendeneuro kommt vor Ort an“, sind im System bekannt und geübt, werden aber natürlich nicht offen gelegt. Ein Beispiel gängiger Praxis, um Verwaltungskosten auf dem Papier zu drücken und damit die Spender bei Spendierlaune zu halten:
Spendenwerbung kostet Geld. Die Organisationen machen ihr Spendenmailing. Klappern ihre bekannten Spender ab. Kaufen neue Adressen dazu. Lassen Bettelbriefe professionell erstellen und versenden. Das kostet Geld. Bis hin zu Provisionen für Agenturen, die darauf spezialisiert sind. Der Aufwand dafür wird nicht den allgemeinen Verwaltungskosten zugeschrieben. Das geht viel eleganter. Das Zauberwort für die Bilanz heißt: Entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit. Das ist damit ein Projekt und keine Position der allgemeinen Verwaltung. Die Verfeinerung davon geht dann noch so: Insofern die „Spenderinformation“, ein besonderes Projekt „vor Ort“ beleuchtet und exakt genau dafür bettelt, wird der Aufwand anteilig den Projektaufwendungen zugeschlagen. Ergo: Auch kein Aufwand für allgemeine Verwaltungskosten. So werden Spender und selbst die öffentlichen Geber an der Nase herum geführt.
Große Organisationen, man kennt sie auch von den Marktplätzen und Fußgängerzonen, beauftragen Werbe- und Drückerkolonnen. Auch das kostet Geld. Sogar viel Geld. Durchschnittlich erhalten diese Platzwerber von jedem gewonnenen Neumitglied mindestens einen Jahresmitgliedsbeitrag. Auch dieses Geld landet also schon einmal gar nicht bei der Hilfsorganisation und vor allem nicht „vor Ort“.
Das Spendenwesen ist, insbesondere was die großen Player angeht, über die letzten Jahre sehr oft zu einem Spendenunwesen verkommen. Darüber wird diese Zeitung noch gesondert berichten. Kritisch. Vom Standpunkt des unabhängigen außenstehenden Beobachters.
Bildquelle:
- Afrika_Kontinent_2: dpa