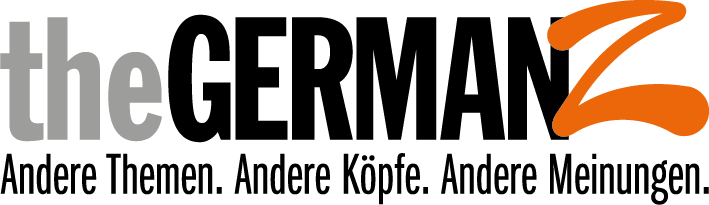von MARC ZOELLNER
Sanaa/Jemen – Es ist ein Bild, das für Entsetzen sorgt: Ein kleines Mädchen, in Kopftuch und Schuluniform, am Boden liegend, das mit starrem Blick auf seinen Ranzen schaut. Ihre Arme sind verkrümmt, aus der Brust sickert Blut langsam in das staubige Erdreich. Vom linken Fuß ragt nur noch ein Stummel aus dem Hosenbein. Er wurde in Fetzen gesprengt von einer Bombe, die auf ihrem Schulhof einschlug; abgeworfen von einem saudischen Militärflugzeug direkt über der „Al-Falah“-Grundschule im kleinen Städtchen Nihm, rund 50 Kilometer nordöstlich der jemenitischen Hauptstadt Sanaa gelegen. Mit dem Mädchen starben noch sieben weitere Kinder, berichtete die staatliche jemenitische Nachrichtenagentur SABA Mitte Januar, kurz nach dem Ereignis. Und die UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, bestätigte: Beim Bombenangriff Saudi-Arabiens auf die Grundschule in Nihm habe es sich keineswegs um einen traurigen Einzelfall gehandelt.
21 Monate tobt der Krieg der arabischen Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens gegen die Huthi-Rebellen des Jemen. Was er hinterlässt, ist ein Anblick von Verwüstung, von zerstörten Städten, von ausradierten Dörfern – und eine der schlimmsten humanitären Katastrophen des 21. Jahrhunderts. Die wenigen Fotos, die seit dem Beginn des Konflikts aus dem Jemen in die Weltöffentlichkeit dringen – Saudi-Arabien selbst lässt kaum mehr Journalisten in das Land einreisen – verdeutlichen auf grausame Weise, welche Schrecken dieser Krieg mit sich bringt. Ein Konflikt, der im Westen weder verstanden noch überhaupt wahrgenommen wird. Dabei ist obiges Foto des kleinen Mädchens aus der Ortschaft Nimh lediglich das letzte in einer Galerie an menschlicher Verzweiflung, unter welcher gerade die Kinder des Jemen zu leiden haben.
„Fast 2.000 Schulen im Jemen können nicht länger benutzt werden, weil sie entweder zerstört oder beschädigt wurden, vertriebene Familien beherbergen, oder aber für militärische Zwecke genutzt werden“, beschreibt die UNESCO-Repräsentantin Meritxell Relano im jemenitischen Fernsehen die aktuelle Situation. „Seit der Eskalation dieses Konflikts haben die Vereinten Nationen den Tod von beinahe 1.400 Kindern verzeichnet. Die wirklichen Zahlen sind jedoch sicher noch viel höher.“
Denn tatsächlich sind, so bizarr es auch klingen mag, die direkten Kampfhandlungen noch nicht einmal das Schlimmste, was die Jemeniten trifft, sondern der auf den Krieg und die Belagerung, die Sanktionen und Embargos folgende Hunger; die Knappheit an Nahrungsmitteln, an Wasser, Strom und Brennstoff, an medikamentaler Belieferung. Die Tresore der Banken in Sanaa, berichtete ein Jemenit gegenüber Journalisten, seien leergeräumt. Es gäbe kein Geld mehr zum Handeln und somit auch keine Möglichkeit, sich auf den Märkten selbst zu versorgen. Ein Teufelskreis mit fatalen Folgen, gerade für die städtische Bevölkerung des dicht besiedelten Nordwesten; des Kernlands der Huthi-Rebellion.
„Aller zehn Minuten stirbt im Jemen ein Kind“, bestätigt Sabri Saleem, Rektor des Yemen College of Middle Eastern Studies (YCMES), einer privaten Sprachhochschule im malerischen Herzen der Sanaaer Altstadt. „Der Norden wurde von der Militärkoalition komplett eingeschlossen. Nichts kommt dort mehr rein oder raus.“ Denn die Blockade der arabischen Koalition, die sich ursächlich gegen den Nachschub an Waffen und militärischem Personal aus dem Iran – einem der Hauptverbündeten der Huthis im Jemen – gerichtet hatte, wirkt sich seit Monaten bereits nicht weniger auch auf die Belieferung der zweieinhalb Millionen Einwohner zählenden, auf einer trockenen Hochebene gelegenen Hauptstadt Sanaa aus; und insbesondere auf deren Importmöglicheiten von Waren des täglichen Bedarfs.
Eine Ende vergangenen Jahres veröffentlichte Studie der UNICEF offenbart ein erschreckendes Ausmaß der Krise im Jemen: So sind mit 18,8 Millionen Menschen mittlerweile rund 70 Prozent der Einwohner der südarabischen Republik von humanitärer Hilfe abhängig, und unter diesen ganze 10,3 Millionen dringlichst. „Als Folge der Krise werden 14,8 Millionen Menschen im Jahr 2017 medizinische Fürsorge benötigen und 4,5 Millionen Nahrungslieferungen“, warnt das Kinderhilfswerk in einer Pressemeldung. „Das ist ein gewaltiger Anstieg im Vergleich zu 2016.“
Denn der Konflikt im Jemen ist ein Krieg, der ebenso viele Fronten wie Wurzeln hat: Allein im Inneren des Landes kämpfen fünf bis aufs Blut miteinander verfeindete Fraktionen miteinander. Im Osten hält die Terrororganisation Al Kaida große, wenn auch nur teilweise bewohnte Landstriche unter ihrer Kontrolle – von der Wüstenregion des Hadramaut bis hin zur jemenitischen Küste am Indischen Ozean. Diese Gegend gilt als heilige Erde der Dschihadistenbewegung; im Hadramaut wurde der Vater des 2011 liquidierten Terrorfürsten Osama Bin Laden geboren. Ebenso im Osten breitet sich seit wenigen Jahren aber auch der Islamische Staat auf: Diesmal in direkter Konkurrenz zu Al Kaida, und diese mit Waffengewalt stetig zurückdrängend.
Im Süden wiederum, speziell um die bedeutende Hafenstadt Aden, träumen separatistische Milizen von einer gewaltsamen Wiedererrichtung der sozialistischen und 1990 mit dem Norden vereinten Demokratischen Volksrepublik Jemen. Ebenfalls im Süden hält sich der geschasste Präsident des Jemen, Abed Rabbo Mansur Hadi, verbarrikadiert. Vor beinahe exakt zwei Jahren, im Februar 2015, floh Hadi, der bis zum Ausbruch des Arabischen Frühlings im Jemen als Vizepräsident unter dem Diktator Ali Abdullah Salih diente, von Sana’a nach Aden, der neuen de-facto-Hauptstadt der Republik, und mit ihm die wenigen noch regierungsloyalen Truppen des Jemen.
Das Gros der jemenitischen Armee hatte sich jedoch rasch den zur gleichen Zeit nahezu im Sturm vorrückenden Huthis angeschlossen gehabt: Jenen unabhängigen Schätzungen zufolge zwischen 100.000 und 260.000 Mann zählenden Milizen der schiitischen Minderheit des Landes; der Anhänger der islamischen Rechtsschule der Zaiditen bzw. Fünferschiiten, welche besondere Verbreitung im nördlichen Jemen besitzen, aber auch im Süden Saudi-Arabiens. „Fünf Kriege hatten die Huthis in der Vergangenheit mit Ali Salih geführt, aber keinen einzigen gewonnen“, erläutert Hochschulleiter Sabri Saleem die historischen Langzeitursachen des vor zwei Jahren neu ausgebrochenen Konflikts. Im Windschatten Salihs, der, wie internationale Beobachter des verworrenen Konflikts vermuten, seinen eigenen Sohn als neuen Präsidenten des Jemen zu installieren versucht und noch immer Teile von Heer und Luftwaffe hinter sich weiß, gedenken die Huthis, sich selbst einen Großteil des Einflusses im südlichen Arabien zu sichern.
Beide Konfliktparteien, sowohl die Huthis im Norden als auch die Hadi-Getreuen im Süden, kämpfen nicht nur gegeneinander, sondern zeitgleich ebenso gegen die Islamisten von Al Kaida und dem Islamischen Staat im Osten des Landes. Unterstützt werden sie in diesem Stellvertreterkrieg dabei auch von ausländischen Mächten: „Niemand weiß, wie der Iran es schafft, Waffen an die Huthis zu liefern, da der Norden ja komplett unter Blockade Saudi-Arabiens steht“, verdeutlicht Saleem. „Aber sie schaffen es, trotz aller Widrigkeiten ihre Schmuggelrouten aufrecht zu erhalten.“ Auch von russischen Militärberatern im Land wird berichtet: „Das ist naheliegend“, so Saleem. „Immerhin sind die einzig noch offenen Botschaften in Sana’a jene Teherans und Moskaus.“
Ausländische Unterstützung von großem Ausmaß erfährt aber auch der jemenitische Präsident Hadi: Allein die fatalen Luftangriffe Saudi-Arabiens zählen mittlerweile in die Tausende, die dabei getöteten Zivilisten über elftausend. Hinzu kommt eine Seeblockade Pakistans sowie die militärische Zurhilfeleistung der meisten arabischen Staaten – von Jordanien über Katar und Kuwait bis hin zu Ägypten und zum Sudan. Und die Vereinigten Arabischen Emirate ließen ab November 2015 gar das umstrittene US-amerikanische Sicherheitsunternehmen Academi, vormals Blackwater, anheuern, um 1.800 aus Kolumbien und anderen lateinamerikanischen Staaten rekrutierte Söldner auf ihren Militärbasen am Persischen Golf auszubilden und später für Hadi im Jemen in den Krieg zu entsenden.
Die Zielsetzung der arabischen Militärförderation ist dabei weit gefächert: Vorrangig, so erklärt Riad immer wieder, ginge es den Golfstaaten um eine Eindämmung des Einflusses des Teheraner Regimes auf die Region. Den Huthis wiederum wird von Seiten der Saudis jedoch ebenso der Gedanke eines Revanchekriegs für jenen von 1934 vorgeworfen. Damals okkupierte Saudi-Arabien entgegen des Protests und später des bewaffneten Widerstands der Jemeniten den nördlichen Siedlungsteil der Zaiditen, welche seitdem je zur Hälfte getrennt im Norden wie im Süden der saudisch-jemenitischen Grenze leben. Die Grenze selbst wurde erst im Jahre 2000 bestätigt; im Zweiten Abkommen von Dschidda und unter der Federführung Ali Salihs – ein Frevel am historischen Erbe der Nation, wie die Huthis damals reklamierten. Und tatsächlich propagieren Teile der Huthi-Miliz auch heute noch die Auferstehung eines Großjemen; bestenfalls in den Grenzen der im späten Mittelalter herrschenden Rasuliden-Dynastie.
Doch worum es den Golfstaaten in diesem Proxykrieg tatsächlich geht, sehen viele Bürger des Jemen ganz anders motiviert. „Saudi-Arabien führt diesen Krieg, um sein Volk von der wirtschaftlichen Krise im eigenen Land abzulenken“, berichtet Saleem. „Überdies nutzen sie den Krieg, um ihre eigenen Waffengeschäfte anzukurbeln. Der Jemen ist ihr Ort, um neue Waffensysteme aus dem Westen zu erproben, denn der Jemen ist ein armes, abgelegenes Land, das sich nicht selbst wehren kann. Wie sonst erklärt es sich, dass über zehn reiche arabische Staaten Saudi-Arabien auf dessen Feldzug unterstützen, seit zwei Jahren schon, und sie alle trotzdem nicht gegen eine einzige kleine Miliz gewinnen?“
Der Krieg des Großen Bruders gegen die Kleine Schwester, wie beide Staaten sich gern untereinander bezeichnen, droht auch im dritten Jahr in Folge, kein gutes Ende und noch nicht einmal einen friedlichen Ausgang zu finden. Gegenteilig ist zu befürchten, dass durch die weitere Intervention der Interessenmächte Iran und Saudi-Arabien ein langer Atem von Leid und Gewalt im einstigen felix arabia, dem glückseligen Arabien, Einzug halten wird. „Unser Schicksal“, erzählt Saleem resigniert, „ist dabei eng mit jenem Syriens verknüpft.“ Und wie im Falle Syriens, so befürchten auch viele Jemeniten den Untergang ihrer Republik in einen failed state sowie die Flucht derer, die es noch vermögen, in entferntere, friedlichere Länder: Nach Europa beispielsweise oder auch nach Nordamerika, wo sich bereits heutzutage größere jemenitische Diasporagemeinden zusammenfinden. Denn vom Krieg im Jemen, so scheint die einhellige Meinung im südlichen Arabien zu lauten, mögen viele profitieren – unter den Jemeniten selbst jedoch nicht ein Einziger.
„Die meisten Jemeniten wollen weder Salih noch Hadi noch die islamistischen Extremisten an der Macht sehen“, so Sabri Saleem. „Sie möchten eine Demokratie für ihr Land. Und vor allem möchten sie endlich wieder in Frieden leben dürfen.“
Bildquelle:
- Jemen_Opfer: marc zoellner