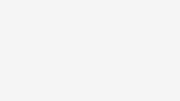von ESTHER VON KROSIGK
MÜNCHEN – Das gemütliche Wirtshaus im Grünen, die kleine Kneipe an der Ecke – es gibt sie noch, aber immer weniger. Vom Wirtshaussterben ist gar die Rede und keine Region in Deutschland scheint davon ausgenommen. Denn aufgrund von Inflation, hohen Energiepreisen und Personalmangel machen mehr und mehr Wirte ihre Lokale dicht. Für immer.
Damit geht auch ein Stück unseres Landes und unserer Identität verloren. Der häufig belächelte Stammtisch, an dem diskutiert, laut über Poltisches gewettert und viele Bierkrüge geleert werden, ist ein urdeutsches Phänomen. Womöglich ist Deutschland nirgendwo deutscher. Zumal sich an dem Tisch mit dem berühmten Messingschild nicht nur mehr alte, weiße Männer versammeln, die Parolen dreschen. Längst ist auch der Stammtisch multikulti geworden und andere gesellschaftliche Gruppen haben das gemütliche Beisammensein in Kneipen, Ratskellern und Dorf-Gaststätten für sich entdeckt. Doch ist es damit bald vorbei?
Das Wirtshaussterben begann lange vor Corona
Schon lange vor Corona waren ein verändertes Freizeitverhalten der Deutschen und Personalmangel im Gastgewerbe Ursachen dafür, dass nicht alles mehr so rund lief wie einst. Hinzu kam eine zunehmende Bürokratie – so etwa Mindestlohn-Dokumentationspflichten und vorgeschriebene Hygieneschulungen für Mitarbeiter. Viele Wirte fanden auch keine Nachfolger für ihr Unternehmen.
Bereits seit den 1990er-Jahren nimmt die Zahl der Wirtshäuser kontinuierlich ab, Betroffen sind vor allem ländliche Regionen. Zwischen 2012 und 2019 schlossen deutschlandweit mehr als 5.000 Schankwirtschaften und Kneipen, wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) herausgefunden hat.
Weil ausgebildete Servicekräfte fehlen, setzen Gastwirte immer häufiger Seiteneinsteiger oder Freelancer ein. Aber können ungelernte Aushilfen oder jobbende Studenten auf Dauer das Können und die Einsatzbereitschaft von Profis ersetzen? Schließlich hängt im Gastgewerbe ganz viel vom Service ab – eine gute (oder schlechte) Dienstleistung am Kunden hat einen hohen Anteil am Umsatz. Angesichts der niedrigen Löhne dürfte sich die Motivation, den Kunden als König zu behandeln, in Grenzen halten. Die schlechte Bezahlung in der Branche ist ein Dauer-Thema. Und so überlegen es sich viele Job-Bewerber kurzfristig anders und erscheinen erst gar nicht zu den vereinbarten Probearbeiten.
Köche und Kellner wanderten während der Pandemie in andere Branchen ab
Die Pandemie mit monatelangen Schließungen und strengen Auflagen bei Wiedereröffnung der Gaststätten, hat die allgemeine Situation weiter verschärft. Nach den ersten Lockdowns wechselten Köche und Kellner wegen fehlender Perspektiven in andere Branchen. Und kehrten nicht zurück – der Spiegel rechnete im März dieses Jahres vor, dass die Zahl der Beschäftigten in Restaurants, Imbissstuben und Cafés gegenüber 2019 um knapp zehn Prozent zurückgegangen sei.
Kein Zweifel: Die Schließungen während Corona lösten einen Strukturwandel aus und die selbstständigen Gastronomen, die keinen Inflationsausgleich erhalten, zahlen indirekt den Preis für die milliardenschweren „Rettungspakete“. Ironischerweise führte die Ampelkoalition gerade in dieser angespannten Situation das „Bürgergeld“ ein – wer will da noch bis in den späten Abend arbeiten und schwere Tabletts mit dreckigem Geschirr schleppen? „Wir bieten keinen attraktiven Arbeitsplatz. Das ist klar“, gab kürzlich der Münchner Wirt Christian Croon gegenüber BR24 zu. „Es ist wie im Krankenhaus oder in der Pflege. Da gibt es Spät- und Nachtdienste. Wir können es nur durch ein gutes Team oder gute Bezahlung wettmachen.“ Gezahlt werden 12 Euro pro Stunde, darauf kommt noch das Trinkgeld – nicht gerade üppig.
Die Zukunft sieht nicht rosig aus, der Nachwuchs fehlt
Aber braucht es denn überhaupt noch Gasthäuser? Wir haben doch Social-Media!, mag sich mancher denken. Nach wie vor jedoch gehen die meisten Menschen gerne auf Tuchfühlung mit anderen und schätzen es, von einer mehr oder weniger freundlichen Bedienung im Lokal umsorgt zu werden, statt selbst am Herd zu stehen.
Damit die Wirtshauskultur erhalten bleibt, haben sich regional schon Bürgerinitiativen gebildet, bei denen Ehrenamtliche das Bier ausschenken. In Bayern hatte das Wirtschaftsministerium bereits 2019 ein Gaststätten-Modernisierungs-Programm aufgelegt, das über eine Brutto-Gesamtfördersumme von 30 Millionen verfügte. Kurz nachdem die Online-Freischaltung erfolgte, erreichte das Antragsvolumen innerhalb weniger Minuten seine Kapazitätsgrenze. Nun, vier Jahre und eine Pandemie später, kämpfen viele mehr denn je in der Branche ums Überleben. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze probiert: Beispielsweise kürzere Öffnungszeiten, etwa von Donnerstag bis Sonntag, weil an den Wochenenden bekanntlich die Leute am liebsten ausgehen.
Die Zukunft sieht allerdings nicht rosig aus
Weil auch Nachwuchskräfte fehlen: Laut Statistischem Bundesamt sank die Zahl der Auszubildenden für Berufe wie Koch oder Restaurantfachmann im Jahre 2020 um ein Fünftel.
Was also tun? Möglich wäre auch dieses Szenario: Im Zeitalter von KI und Robotik könnten Service-Roboter die Arbeit übernehmen – das wird unter anderem in Hotels im Schwarzwald getestet. Dann doch lieber Social Media, denn wer möchte sich schon von Maschinen das Bier zapfen lassen?
Bildquelle:
- Altstadt_Kneipen: pixabay