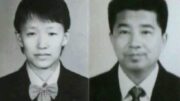Gastbeitrag von RAINER STENZENBERGER
BERLIN – Sie sind ähnlich beliebt wie Steuern, gelten oft als willkürlich und mittelalterlich. Beim Gegenüber findet man sie viel zu hoch, selbst möchte man allerdings nicht darauf verzichten, schließlich soll die eigene Industrie beschützt werden. Die Rede ist von einem Instrument, welches der Mann im Weißen Haus in sein Herz geschlossen hat: Zölle.
Sie sind ein zentrales Element wirtschaftlicher Auseinandersetzungen zwischen Staaten und reichen historisch weit zurück.
Schon im 19. Jahrhundert dienten sie sowohl als Einnahmequelle für Staaten als auch als Schutzinstrument für heimische Industrien. Im 20. Jahrhundert führten Freihandelsabkommen und multilaterale Organisationen wie die WTO zu einem schrittweisen Abbau von Handelshemmnissen. Die Geschichte der EWG und EG waren von großem wirtschaftlichen Erfolg gekrönt, Deutschland verzeichnete die höchsten Wachstumsraten der Nachkriegszeit – unter anderem, weil innereuropäische Zölle abgeschafft wurden. Der Trend bei den hochmodernen Nationen verläuft eher in Richtung niedriger bis keiner Zölle.
Präsident Donald Trump hingegen hat die Zölle wieder als Druckmittel in den Vordergrund gerückt, um wirtschaftliche Ungleichgewichte auszugleichen und eine Re-Industrialisierung der USA voranzutreiben. Er wird vielfach dafür kritisiert, insbesondere auch wegen der ihm eigenen drastischen Art, seine Politik zu kommunizieren. Aber wie sehen die Fakten aus?
Ein reales Zollungleichgewicht
Es ist unbestreitbar, dass es ein Zollungleichgewicht zu Lasten der USA gibt. Während die durchschnittlichen Einfuhrzölle in den USA bei etwa 2,4 Prozent liegen, erhebt die EU in vielen Bereichen deutlich höhere Zölle.
Beispielsweise beträgt der EU-Zoll auf US-amerikanische Autos 10 Prozent, während die USA auf EU-Autos nur 2,5 Prozent erheben. Dazu kommt in der EU die Einfuhrumsatzsteuer, die es in den Staaten so nicht gibt. Auch China profitiert massiv von niedrigen US-Zöllen, während es selbst hohe Importzölle und erhebliche Handelsbarrieren gegen US-Produkte und zahlreiche Dienstleistungen aufrechterhält.
Allerdings gibt es auch eine andere Seite der Medaille
Präsident Trump spricht nicht zufällig vor allem von Industrieprodukten. Die USA haben einen starken Überschuss im Dienstleistungshandel mit Europa. Besonders Unternehmen aus dem Technologiesektor – darunter Google, Amazon und Microsoft – erzielen hohe Gewinne durch digitale Dienstleistungen und Cloud-Services in Europa. Würde die EU eine Digitalsteuer einführen, wie derzeit diskutiert, könnte dies massive Nachteile für US-amerikanische Unternehmen bedeuten und das wirtschaftliche Gleichgewicht in die entgegengesetzte Richtung verschieben.
Nichttarifäre Handelshemmnisse
Mindestens genauso wichtig wie ungleiche Zölle sind die sogenannten nichttariffären Handelshemmnisse, insbesondere durch China und in Teilen auch durch Japan. So müssen ausländische Unternehmen in China oft Joint Ventures mit chinesischen Partnern eingehen und ihr technisches Know-how offenlegen, was langfristig zu Wettbewerbsnachteilen führt, im schlimmeren Fall auch zum Diebstahl geistigen Eigentums. Außerdem gibt es zahlreiche Subventionen für chinesische Unternehmen, die ihnen auf dem Weltmarkt Vorteile verschaffen. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass die US-Regierung auf mehr Fairness drängt.
Die Kritik an Trumps Vorgehen
Während das Ziel Trumps – fairere Handelsbedingungen – wirtschaftlich sinnvoll ist, ist sein Vorgehen umstritten. Die drastischen und teilweise willkürlich wirkenden Maßnahmen haben zu Spannungen mit langjährigen Verbündeten geführt. Warum werden etwa keine Zölle auf russische Waren verhängt, wohl aber auf Produkte aus der Ukraine, die jeden Cent für den Krieg gegen genau dieses Russland benötigt? Die Systematik seiner Politik bleibt in vielen Bereichen unklar, und sie sorgt für Unsicherheit auf den Märkten.
Re-Industrialisierung der USA
Trump verfolgt jedoch nicht nur das Ziel, höhere Zölle durchzusetzen. Sein eigentliches Anliegen ist eine umfassende Re-Industrialisierung der USA. Er möchte, dass Unternehmen wie Apple und Nike ihre Produktion aus Asien zurückholen oder dass neue Fabriken der Handelspartner in den USA entstehen. Ähnlich verlief es bereits in den 1990er Jahren. Damals entstand ein starkes Ungleichgewicht beim Handel mit Automobilen und die USA erhoben sogar eine hohe Luxussteuer auf importierte, teure Autos, was besonders deutsche Hersteller betraf. In der Folge siedelten sich sowohl japanische als auch deutsche Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, einige japanische auch in Großbritannien. Um Währungsschwankungen und Zöllen zu entgehen. BMW baute eine Fabrik in Spartanburg, Mercedes eine Produktionsstätte in Tuscaloosa.
Diese Stoßrichtung der höheren Zölle hat durchaus ökonomischen Sinn und könnte langfristig Arbeitsplätze schaffen. Auch China und Indien beschreiten diesen Weg seit Jahren, um ihre Industrie zu schützen sowie von der Ansiedlung ausländischer Unternehmen zu profitieren.
Die Risiken protektionistischer Politik
Trotz der möglichen Vorteile gibt es erhebliche Risiken, wenn Handelskonflikte eskalieren. Es mögen Arbeitsplätze entstehen, aber höhere Importpreise gehen zu Lasten der Konsumenten, könnten die Inflation in den USA anheizen. Die Unsicherheit an den Märkten könnte zu Wertverlusten an den Börsen führen, zu schlechterer Altersversorgung vieler Amerikaner, die dazu häufig auf Aktien setzen, und zum Vertrauensverlust bei Investoren. Zudem könnten Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder zu neuen wirtschaftlichen Schäden führen – nicht nur für die USA, sondern für die gesamte Weltwirtschaft.
Fazit: Ein weltweiter Deal ist nötig
Die aktuelle Zollpolitik von Präsident Trump hat sowohl Licht als auch Schatten. Während das Ziel, fairere Handelsbedingungen zu schaffen, nachvollziehbar ist, sind seine Methoden oft umstritten.
Eine Lösung könnte in umfassenden Handelsabkommen liegen, die Zölle weltweit senken und gleichzeitig faire Rahmenbedingungen schaffen. Statt eines endlosen Zollkriegs wäre es sinnvoller, umgehend auf Verhandlungen zu setzen und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen Industrie- und Dienstleistungshandel zu finden. Insbesondere die EU sollte auf Präsident Trump zugehen und ihm rasch einen Deal anbieten.
Bildquelle:
- Handelsschiffe am Hafen-Terminal: depositphotos/PantherMediaSeller